
Qualität oder Popularität – es gibt deutliche Unterschiede zwischen Wissenschaft und Gesellschaft (Foto: Wikimedia Commons)
In den letzten Wochen musste ich einiges über mich ergehen lassen, von Menschen, die ich eigentlich sehr hoch schätze: Kritik an meinem Blog, persönliche Beschimpfungen – vor und hinter den Kulissen –, Vorwürfe, ich sei unseriös, und deutliche öffentliche Ankündigungen (oder Aufforderungen?), dass man lieber nichts mit mir zu tun haben wolle.
Doch kein Selbstmitleid: So ist das nun einmal, wenn man den Kopf aus dem Fenster streckt, dann muss man auch damit rechnen, im Regen nass zu werden. Der Kopf aus dem Fenster – das ist die Wahl zum „Wissenschaftsblog des Jahres“, die ich seit vier Jahren veranstalte und die wachsende Aufmerksamkeit in der Szene gewinnt. Dabei treten Blogs im klassischen Sinne der Wissenschaft mal direkt, mal getrennt gegen Blogs an, die alles andere als wissenschaftlich sind, sich aber mit dem Wort „Wissenschaft“ schmücken. Warum ich das tue? Zwei Welten miteinander zu vergleichen, die sich eigentlich in leidenschaftlicher Ablehnung gegenüberstehen. Nun, weil man dabei sehr viel lernen kann. Lernen über Strömungen in unserer Gesellschaft, lernen über Wissenschaft und Wissenschaftler und vor allem über das Verhältnis dieser Gesellschaft zur Wissenschaft. Und dieses Verhältnis Gesellschaft-Wissenschaft ist – wenn man es ernst nimmt – das Fundament der Wissenschaftskommunikation.
Wissenschaft lebt und arbeitet in unserer Gesellschaft, für diese Gesellschaft und von dieser Gesellschaft. Deshalb braucht Wissenschaft diese Gesellschaft. Auf der anderen Seite braucht natürlich auch die Gesellschaft die Wissenschaft, ganz wesentliche kulturelle Werte, unser Weltbild, unser Wissen, und nicht zuletzt ein guter Teil des Wohlstands und unserer Zivilisation beruhen auf Wissenschaft. Am besten hat dieses gegenseitigeseitige Abhängigkeitsverhältnis wohl die Wissensgesellschaft GDNÄ vor zweieinhalb Jahren in einem Tagungsmotto auf den Punkt gebracht: Gesellschaft braucht Wissenschaft – Wissenschaft braucht Gesellschaft.

32 Prozent Wissenschafts-Skeptiker – „Die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren
Gefühlen und dem Glauben.“ (Quelle: WiD)
Nun haben aber Wissenschaftler – und meist auch Wissenschaftskommunikatoren – in der Gesellschaft vor allem nur diejenigen im Blick, die sich für Wissenschaft interessieren, die sie als wichtigen und generell positiven Faktor unserer Gesellshaft sehen. Das aber ist – wie repräsentative Umfragen zeigen – in unserem Land eher die Minderheit. Nehmen wir das Wissenschaftsbarometer von „Wissenschaft im Dialog“: In keiner der entscheidenden Fragen geht die Zahl der Wissenschafts-Befürworter über 50 Prozent. Der Rest sind Gleichgültige oder Wissenschafts-Skeptiker (dabei handelt es sich zudem um Selbstauskünfte, also die Befragten behaupten von sich selbst, sich für Wissenschafts zu interessieren, Wissenschaftlern zu glauben usw. – ob sie es wirklich tun, kann nicht nachgeprüft werden). Sogar ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist der Meinung: „Die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben.“ Mindestens ein Drittel also ist Wissenschafts-skeptisch! In einer Demokratie eine gehörige Minderheit. Soll Wissenschaft an diesen Menschen vorbei gehen? Das wäre ein großer Fehler.
Denn wenn Wissenschaftskommunikation die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft darstellt, dann muss sie eine so große Minderheit im Auge haben. Was aber wissen wir über diese Menschen? Ich denke, herzlich wenig, und da will ich mich persönlich gar nicht ausnehmen. Nur vielleicht so viel: Es sind wahrscheinlich nicht die Leser von „bild der wissenschaft“, wohl kaum die regelmäßigen Besucher der Wissenschaftsseiten und Wissenschaftsjournale, die Betrachter von Wissenschaftssendungen im Fernsehen oder der Wissenschaftsnachrichten im Internet, ob „Spiegel online“ oder in den „Helmholtz-Blogs“. Diese Menschen holen sich ihre Informationen und Interpretationen in Medien und auf Blogs im Esoterischen, Pseudowissenschaftlichen, Ideologischen, Anonymen, Skeptischen, voreingenommen Antiwissenschaftlichem wie „Grenzwissenschaft-aktuell“, „EIKE“, „Kalte Sonne“, „Kritische Wissenschaft“ oder „Science Skeptical“. Diese Medien existieren und haben großen Zuspruch – die große Zahl Wissenschafts-skeptischer Bürger, die etwa im Wissenschaftsbarometer aufscheint, ist keineswegs nur eine statistische Größe, die man übersehen könnte. Das war die erste Lehre, die ich aus den Wahlen des „Wissenschafts-Blogs des Jahres“ gezogen habe.
Und noch etwas musste ich erfahren, durch Kommentare zu den Wahlen und zu den Ergebnissen, aber teils auch durch heftige E-Mail Diskussionen hinter den Kulissen: Das Engagement und die Begeisterungsfähigkeit, also das emotionale Potenzial der Wissenschafts-Skeptiker ist enorm. Das zeigt die Zahl der Stimmen, die auf diese Blogs entfielen, das zeigt auch der Verlauf der Stimmabgabe: An Wochenenden oder abends, und sogar nachts, wenn bei den wissenschaftskonformen Blogs (die werden eher zu Business-Zeiten gelesen) die große Flaute herrschte, da kamen die Stimmen der Wissenschafts-Skeptiker. Und außerdem sind sie diskutierfreudig und erst recht nicht konfliktscheu, wie die ungezählten Kommentare und Mails belegen. Vieles im Verhalten der Wissenschafts-Skeptiker erinnert an die oft zitierten „Wutbürger“. Und was derart engagierte Minderheiten bewegen können, zeigen Beispiele wie „Stuttgart 21“ oder in jüngster Zeit die furchtbaren „Pegida“-Auftritte.
Ich denke, Wissenschaftskommunikation sollte gesellschaftliche Strömungen der Wissenschafts-Skepsis ernst nehmen. Es sind keine Randgruppen, sie sind keine vorübergehende Erscheinung, dazu sind sie zu viele und außerdem spricht ihr großes Engagement auch für gehörige politische Durchschlagskraft – wenn einmal die goldenen Zeiten des politischen Höhenflugs der Wissenschaft vorbei sind. Wie es dann bei uns aussehen könnte, führt die Kreationismus-Debatte in den USA drastisch vor Augen.
Eine Auseinandersetzung mit den Wissenschafts-Skeptikern aber im belehrenden „Wir wissen es besser“-Stil, wie ihn etwa die GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften) pflegt, ist da sicher nicht hilfreich. Denn dieses Vorgehen geht vom Defizit-Modell aus (also der Vorstellung, dass die Ursache für Skepsis gegenüber Wissenschaft mangelndes wissenschaftliches Wissen wäre) und dies hat sich inzwischen als falsch erwiesen. Viel wichtiger wäre es, die Motive zu hinterfragen: Was bewegt diese Menschen? Welche Vorstellungen, Ziele, Motivationen, Werte haben sie? Auf welche Argumente sprechen sie an? Doch da gibt es bisher kaum etwas. Hier müssen Sozialwissenschaften ansetzen, auch Instrumente wie das WiD-Wissenschaftsbarometer könnten Hilfestellung leisten. Auf jeden Fall müssen wir mehr über die Wissenschafts-Skeptiker wissen. Sie sind eine unentdeckte gesellschaftliche Kraft – tatsächlich sogar eine „schweigende Mehrheit“?.
Ich staune immer wieder, was man nicht aus einer Wahl zum „Wissenschafts-Blogs des Jahres“ lernen kann, worauf man nicht alles durch die – zugegebenermaßen oft mühsamen – Diskussionen stößt! Und nicht nur über die Wissenschafts-Skeptiker habe ich etwas gelernt, sondern auch über Wissenschaft und Wissenschaftler (und das nach über 40 Jahren Beschäftigung mit der Materie!). Aber eigentlich ahnte ich das schon vorher und es wurde mir jetzt eindrücklich bestätigt: Schon kurz nach der PUSH-Initiative im Jahr 1999 habe ich in einem Editorial von „bild der wissenschaft“ kommentiert, dass es eigentlich genauso wichtig wäre, neben einer „Public Understanding of Science and Humanities“-Initiative, eine SUP- oder eine SUS-Initiative ins Leben zu rufen (gemeint als „Science Understanding of Public“ – oder besser noch „of Society“).
Daran musste ich jetzt immer wieder denken. Denn natürlich habe ich um Ausschreibung und Ergebnisse nicht nur mit Wissenschafts-Skeptikern diskutiert, sondern auch mit Wissenschaftlern oder wissenschaftsnahen Partnern. Und da hat sich gezeigt: Viele von ihnen (löbliche Ausnahmen existieren!) verstehen überhaupt nicht, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und vor allem nicht, dass diese Gesellschaft ganz anders funktioniert als die Wissenschaft: In dieser Gesellschaft geht es nicht darum, wer recht hat, sondern wer mehr Menschen auf seinen Weg mitnehmen kann. Hier zählen nicht die besseren Argumente, sondern die Mehrheiten. Hier spielen Emotionen eine viel wichtigere Rolle als Erkenntnisse, Sachargumente sind wichtig, aber allein kaum ausschlaggebend. Hier geht es nicht um wohlabgewogene „richtige“ Entscheidungen, sondern um Aktionen, mit denen Medien und Wähler zu überzeugen sind. Hier zählt auch nicht die Wahrheit (vulgo: Wirklichkeit), sondern der durchsetzungsfähige Kompromiss.
Nur ein kleines Beispiel, woran sich die Unterschiede in den Funktionsweisen von Wissenschaft und Gesellschaft immer wieder in den Diskussionen um den „Wissenschafts-Blog des Jahres“ bemerkbar gemacht haben: Immer wieder warfen mir Kritiker der Wahl vor, dass ich damit den Wissenschafts-skeptischen Blogs (die zuletzt gar nicht zur Wahl zum „Wissenschafts-Blog des Jahres“ nominiert waren, sondern in einer getrennten Wahl zum „Blogteufelchen der Wissenschaftskritik“ – mit bewusster sprachlicher Differenzierung, inklusive Relativierung und Diminuitiv) ein Qualitätsmerkmal umhängen würde. Weit gefehlt: Bei Wahlen gewinnt nicht der Beste sondern der Populärste (jeder kennt dies aus dem politischen Alltag: allzuoft gewinnt aus subjektiver Sicht die falsche Partei). Und für die Qualität der Kandidaten ist nicht der Veranstalter verantwortlich, er legt lediglich die Regeln fest, die für alle gelten.
Mit Wahlen (das gleiche gilt für Umfragen) lässt sich keine Qualität messen – ganz besonders wenn sie im Internet stattfinden, das schon technisch keine zuverlässige Stimmabgabe erlaubt. In der Wissenschaft finden Wahlen kaum statt (mit Ausnahme einiger meist nicht erkenntnisorientierter Gremien). Hier werden Auszeichnungen vergeben, bei denen hochkompetente Jurys entscheiden, die Juroren mit ihrem Ansehen für die Qualität stehen. Übrigens auch hier ist es (abgesehen von einzelnen Ausnahmen) so, dass sich der Einzelne nicht aktiv beteiligen muss. Das gilt auch für Umfragen: Er wird nominiert – weil er als aussichtsreich gilt, weil man einen Zählkandidaten braucht oder aus anderen Gründen – und aus der „Volksabstimmung“ findet sich dann der Sieger. Das ist so bei der Bambi-Wahl, beim Polit-Barometer, beim ARD-Deutschlandtrend und natürlich auch beim „Wissenschafts-Blog des Jahres“. Ob die Gewählten damit zufrieden sind oder nicht, entscheidet sich erst mit dem Ergebnis. Denn es geht nicht um deren Ambitionen, sondern um ein Stimmungsbild zur Beliebtheit der Kandidaten.
Manchmal lehnt der gekührte dann die Auszeichnung ab, sowie seinerzeit Marcel Reich-Ranicki den Deutschen Fernsehpreis. Zugegeben, mir ist nicht bekannt, ob schon einmal ein Gewinner das „Bambi“ abgelehnt hat, wie es im letzten Jahr der Sieger Florian Freistetter mit seinem Blog „Astrodicticum Simplex“ mit der Auszeichnung „Wissenschafts-Blog des Jahres“ getan hat. Aber die Bambi-Verleihung rückt ja jedes Jahr mit einer prächtigen Fernsehübertragung die Ausgezeichneten spektakulär ins Rampenlicht. Na ja, soweit sind wir mit dem „Wissenschafts-Blog des Jahres“ noch nicht. Aber hypothetisch gesprochen, wenn wir einmal soweit kommen sollten, wie es dann wohl um die Kritik steht? Eines ist sicher: Bis dahin habe ich noch viel mehr gelernt.


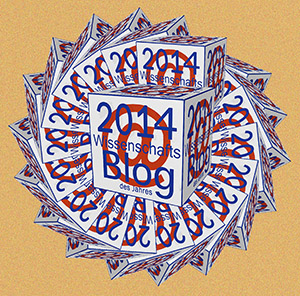

Klaus Ermecke
7. Februar 2016
Herr Korbmann, da unten auch mein Name auftaucht, nur ganz kurz:
Ich halte es generell für den intellektuellen Austausch nicht förderlich, wenn Dinge unsystematisch zusammengemanscht werden. Es gibt Leute, die das CO2 Klimadogma mit richtigen, und welche, die es mit falschen Argumenten kritisieren. Andere Leute fabulieren z.B. von „Chemtrails“. Nichts hat mit irgend etwas von dem anderen zu tun.
Weil es schon wieder um die Klimadebatte geht: Die Klima-Alarmisten (alle) behaupten, daß ein Konzentrationsanstieg von CO2 oder anderen IR-aktiven Gasen zu einem Temperaturanstieg der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre führt.
Nehmen wir an, es wäre so. Dann würde die Temperatur der mittleren und höheren Luftschichten ebenfalls steigen (das wissen wir von der Beobachtung der jahreszeitlichen Temperaturänderungen).
Und gleichzeitig würde die Abstrahlung ins Weltall (von uns „Kühlleistung“ genannt) ebenfalls ansteigen. Denn Emission von IR-Strajhlung ist temperaturabhängig. Die jüngst vom IPCC postulierte „Erderwärmung“ von 4 Grad würde – grob überschlägig – einen Anstieg der Kühlleistung von 6 Prozent bewirken.
Und damit ist das Thema auch schon durch. Ein Ereignis, das einen Anstieg der Kühlleistung der Erde nach sich ziehen würde, kann nur eintreten, wenn VORHER die Heizleistung hochgefahren wird. CO2 aber kann der Erde keine zusätzliche Leistung zuführen.
http://www.ke-research.de/downloads/Stellungnahme-Klima-Niedersachsen.pdf
http://www.ke-research.de/downloads/Klimaretter.pdf
Ich bin weder Ingenieur noch „Klimarealist“, noch habe ich oder haben sich meine Berater zu diesem Themenbereich jemals so genannt.
LikeLike
jsbielicki
17. April 2015
Hat dies auf psychosputnik rebloggt.
LikeLike
Günter Heß
26. März 2015
Lieber Herr Korbmann,
mit diesem Satz:
„Daran krankt nicht nur die Kommunikation mancher Wissenschaftler, sondern vor allem auch die der Freunde von den ScienceFiles.“
beweisen sie sehr schön das Anliegen von ScienceFiles indem sie einfach unbelegt eine Behauptung kommunizieren, die auch noch einen „ad hominem“ Aspekt hat und sie im vagen bleiben.
Dieser Satz von ihnen ist für mich ein Ausdruck schlechter Kommunikation.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Heß
LikeLike
Günter Heß
23. März 2015
Lieber Herr Korbmann
ich habe den Eindruck, dass Sie wie es Peter Heller in einem Kommentar beschrieben hat, einfach Wissenschaft mit Wissenschaftlern gleichsetzen die an den von der öffentlichen Hand bezahlten Institutionen ihrer Wissenschaft nachgehen.
Kritik an diesen Institutionen und zum Beispiel der Klimawandelleugnerrhetorik die von manchen dieser Institutionen ausgeht ist für mich eine politische Kritik und keine Wissenschaftskritik und auch keine Antiwissenschaft. Auch das Ablehnen der politischen Schlussfolgerungen der IPCC Lobbyberichte “Summary for Policymakers” ist keine Antiwissenschaft, sondern Kritik eines politischen Lobbyberichtes. So ähnlich wie ja politische Parteien die Lobbyberichte der Tabakindustrie kritisieren.
Wissenschaft ist aber stattdessen eine Gesamtheit von Erfahrungen, Erkenntnissen und Beobachtungen die am besten in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht werden. Das muss aber nicht sein, weil man auch in anderen Medien wissenschaftliche Erkenntnisse finden kann. Das können Blogs, Laborbücher, etc sein.
Wissenschaft enthält übrigens auch falsche Ergebnisse, Fehlexperimente, Fehlinterpretationen und falsche Schlussfolgerungen. Naturwissenschaftler haben deshalb auch keine Probleme damit voneinander abweichenden Interpretationen oder konkurrierenden Theorien die beide die Experimente und Beobachtungen erklären.
Die Geschichte zeigt, dass das auch das die Wissenschaft nach vorne bringt und wenn nur die Studenten daraus lernen. Ernst Mach hat die Atomtheorie abgelehnt (geleugnet in der Terminologie der politischen Klimadebatte, bin ich jetzt automatisch antiwissenschaftlich?) und trotzdem ein großes wissenschaftliches Vermächtnis hinterlassen.
Antiwissenschaft zeigt sich deshalb nicht durch falsche Aussagen aus, sondern dadurch, dass nicht kommuniziert wird wie man zu bestimmten Aussagen kommt. Oder wenn Ergebnisse in einem Bericht unterdrückt werden, weil sie der Schlussfolgerung widersprechen könnten.
Wenn zum Beispiel jemand schreibt:
“Weil CO2 ein infrarotaktives Gas ist kann es nur kühlen und der Treibhauseffekt existiert deshalb nicht”
Dann ist das nicht Antiwissenschaft, sondern nur falsch.
Diese Gesamtheit genannt Wissenschaft ist aber im Fluss und lebt von der skeptischen Diskussion über diese Erfahrungen, Erkenntnissen und Beobachtungen. Ernsthafte Kommunikation dieser Ergebnisse erfordert aber, dass man auch die skeptische Diskussion und die Unsicherheiten darstellt. Das ist aber genau was wir bei ScienceSkeptical tun, wenn wir über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Physik der Atmosphäre schreiben. Herr Krüger stellt dann zum Beispiel Ergebnisse aus der Originalliteratur vor, berichtet über beliebte Irrtümer, sowie Unsicherheiten und gibt seinen Lesern Gelegenheit darüber zu diskutieren.
Wissenschaftskommunikation sollte deshalb nicht nur die Erkenntnisse als abgesicherte Ergebnisse darstellen, sondern auch den Prozess beschreiben wie man dazu kommt sowie lebendige Diskussionen transparent darstellen.
Gute Wissenschaftskommunikation zeichnet sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie um die gesicherten Erkenntnisse herum die Unsicherheiten und das was wir nicht wissen darstellt.
Grüße
Günter Heß
LikeLike
Reiner Korbmann
24. März 2015
Lieber Herr Hess,
Kommunikation setzt vor allem auch zuhören und anerkennen der Position des anderen voraus. Daran krankt nicht nur die Kommunikation mancher Wissenschaftler, sondern vor allem auch die der Freunde von den ScienceFiles.
Ihr Reiner Korbmann
LikeLike
Peter Heller
26. März 2015
Lieber Herr Korbmann,
Sie halten Science Skeptical und Kritische Wissenschaft für esoterisch, pseudowissenschaftlich, ideologisch, anonym, skeptisch und voreingenommen antiwissenschaftlich. Darum geht es. Nun sollen wir diese Position also “anerkennen”?
Ich stolpere ja schon über das „anonym“, was allein schon durch meine Existenz (und die von Günter Heß) widerlegt wird. Auch stellt sich die Frage, was das Wort „skeptisch“ in dieser Aufzählung zu suchen hat. Und für die übrigen Kriterien hätte ich gerne ein paar Belege.
Dann kann man diskutieren. Ich würde Ihnen ja sehr gerne sehr genau zuhören. Aber dazu müssen Sie dann auch etwas zur Sache sagen.
LikeLike
Hans Diehl
10. April 2015
Hallo Herr Korbmann.
Wie wahr Ihre Worte. was anerkennen der Position des anderen betrifft.
Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Energiewende, und dem EEG, in der Tat ein komplexes Thema, für das man schon eine Weile benötigt, um bis in Details durchzublicken.
Ich versuche sowohl im Sience Blog als auch bei EIKE, diesbezügliche, „Stammtisch“ gerechte Darstellungen zu kommentieren, und ins richtige Licht zu rücken.
Wer da anderer Meinung ist, wird sofort als Forentroll bezeichnet. Wenn man dann mit seinen Argumenten – gestützt auf belastbare Quellen – der Realität unausweichlich näher kommt, werden Kommentare einfach nicht mehr gebracht.
Aktuelles Beispiel, bei Sience von heute Mittag.
Zitat:
Michael Krüger sagt.
Und das “Paradoxon” und “Faule Ei” von 2010 haben Sie hier jetzt genug erklärt, ab hier werde ich alle weiteren Kommentare von Ihnen löschen. Eine weitere Diskussion ergibt mit Ihnen keinen Sinn, da Sie ganz einfach ideologisch verblendet sind.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Diehl
LikeLike
Peter Heller
14. Februar 2015
Schön, Herr Korbmann, jetzt haben Sie also die Katze aus dem Sack gelassen. Nun weiß ich endlich, was Sie wirklich denken.
Zitat: „Es sind wahrscheinlich nicht die Leser von „bild der wissenschaft“…“
In der Tat. Ich habe bdw abbestellt ungefähr zu der Zeit, als Sie dort als Chefredakteur aufgehört hatten. Denn nach Ihrem Weggang setzte ein schneller Qualitätsverlust ein. bdw verkam zu einer oberflächlichen Illustrierten.
Dem Wettbewerb bin ich übrigens treu geblieben (Spektrum der Wissenschaft, Technology Review, Raumfahrt Concret u.ä.).
Aus Ihrem Artikel oben lerne ich jetzt also: Wer nicht der Auffassung ist, der Klimawandel sei eine Katastrophe, der befindet sich „im Esoterischen, Pseudowissenschaftlichen, Ideologischen, Anonymen, Skeptischen, voreingenommen Antiwissenschaftlichem“.
Wow. Da muß man erst einmal drauf kommen. Wissenschaft hat sich also in den Dienst einer Ideologie zu stellen und wer dem Ansatz nicht folgen mag, agiert antiwissenschaftlich.
Zitat: „Was aber wissen wir über diese Menschen? Ich denke, herzlich wenig, und da will ich mich persönlich gar nicht ausnehmen.“
Ein wahres Wort. Sie haben wahrscheinlich noch nicht einen Artikel auf Science Skeptical gelesen. Nicht einen einzigen. Aber Sie wissen natürlich ganz genau, daß Leute wie wir „antiwissenschaftlich“ argumentieren. Da kann man Ihnen mit Ihrer 40jährigen Erfahrung natürlich nichts mehr vormachen.
Schade. Ich habe mal viel von Ihnen gehalten.
Wissenschaft braucht wohl eher mehr Leute wie uns, die sie aus den Klammern politisch-ideologischer Schranken befreit sehen wollen. Journalisten wie Sie sind dagegen eher nicht hilfreich. Denn die Wissenschaftsfeindlichkeit, die Sie oben zurecht ansprechen und kritisieren, wird durch Sie eher noch geschürt.
LikeLike
Reiner Korbmann
15. Februar 2015
Lieber Herr Heller,
es tut mir leid, wenn ich Sie enttäuscht habe, aber ich hatte noch nie die Katze im Sack: Ich engagiere mich für eine gute Wissenschaftskommunikation, weil ich Wissenschaft und die Kommunikation der Wissenschaft mit der Gesellschaft für wichtig halte. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Sie nennen das „Ideologie“ – bitteschön. Und Sie glauben, Sie sind ohne „Ideologie“? Sorry, geht das überhaupt, ohne eigene Grundüberzeugungen? Aber einmal ganz ehrlich: Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der jeder, der eine andere Überzeugung hat als man selbst, für ein Feind gehalten wird? Kann man nicht mehr miteinander sprechen, diskutieren, ja auch voneinander lernen, ohne gleich dessen Überzeugung sein zu müssen? Wo bleibt die Toleranz? Es wäre eine traurige Gesellschaft. Und übrigens, wenn Sie sich nicht bei den Skeptischen wiederfinden, weshalb nennen Sie dann Ihren Blog so? Und ideologiefrei ist er ja nun wirklich nicht (siehe „Der Wissenschafts-Blog des Jahres 2013 ist gewählt“. Wie sagte doch der Geisterfahrer, als er im Radio die Warnung vor dem Geisterfahrer hörte: „Was, nur ein Geisterfahrer? Nein – Dutzende.“
LikeLike
Peter Heller
15. Februar 2015
Lieber Herr Korbmann,
es ist eigentlich ganz einfach. Oben zitieren Sie das Wissenschaftsbarometer. Und bezeichnen die 32%, die da sagen “Die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben.” als Wissenschaftsskeptiker.
Science Skeptical hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese 32% aufzuklären. Ich wäre in dieser Umfrage bei den knallgelben Männchen gewesen: „Vertraue der Wissenschaft voll und ganz.“ Und das gilt auch für alle anderen unserer Autoren, die durch die Bank (mit einer Ausnahme) eine akademische Ausbildung in naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen vorweisen können. Natürlich erreichen wir diese 32% nicht, denn die lesen uns nicht. Unsere Leser sind überwiegend ebenfalls Naturwissenschaftler und Ingenieure.
Richtig ist allerdings, daß nur ein verschwindend geringer Bruchteil unserer Autoren und Leser noch dem institutionalisierten (staatlichen) Forschungsbetrieb angehört. Die weitaus meisten arbeiten in der Industrie. Aus gutem Grund. Wir sind skeptisch gegenüber einer Wissenschaft, die sich von Politik abhängig macht, die sich in (vorauseilendem) Gehorsam selbst beschränkt, um nicht den Fluß staatlicher Mittel zu gefährden, die gar glaubt, Politik determinieren zu müssen. Daher der Name unseres Blogs.
Dabei gibt es eigentlich nur ein Thema, bei dem wir wohl gegen die Mehrheit der staatlich finanzierten Forscher argumentieren. Und dies ist die Frage, ob der Klimawandel eine Katastrophe ist/sein könnte, die man durch vorsorgende Politik zu vermeiden trachten sollte. Denn es sind nach unserer Ansicht genau die Klimaschützer, die eher ihren Gefühlen und Glaubenssätzen folgen, als einer rational begründeten Wissensbasis.
Bei allen anderen unserer Themen (diverse Energietechnologien, Mobilität, Gentechnologie, Bergbau, Ernährung u.ä.) wirken wir eher als Übersetzer von der Fachwelt in eine interessierte Öffentlichkeit.
Die Kritik, die Ihnen aufgrund der Auswahl der Kandidaten zum Wissenschaftsblog entgegengebracht wurde, ging ausschließlich (zumindest der Teil, den ich öffentlich wahrnehmen konnte) von einer kleinen und eng vernetzten Gruppe von Klimaschützern des oben beschriebenen Charakters aus. Von Leuten also, die eigentlich selbst hart an der Grenze zwischen Wissenschaft (der Faktenbasis) und Esoterik (dem Gefühl und dem Glauben) lavieren. Für diese sind Blogs wie der unsere natürlich unerträglich.
Daß Sie sich von diesen Leuten beeinflussen lassen, enttäuscht mich. Ich hätte Ihnen mehr Selbstbewußtsein zugetraut, als nun mit einer Formulierung wie „Blogs im Esoterischen, Pseudowissenschaftlichen, Ideologischen, Anonymen, Skeptischen, voreingenommen Antiwissenschaftlichem“ zu Kreuze zu kriechen. Noch dazu ohne sich selbst davon zu überzeugen, ob das auch zutreffend ist oder nicht.
Noch ein Punkt: Ich bin an der Universität von einem Professor ausgebildet worden, der selbst aktives Mitglied der GWUP war. Was ich von diesem gelernt habe, prägt mich bis heute. Ihre Einschätzung dieser Organisation ist ebenfalls völlig daneben. Und den Gebrauch des Wortes „Skeptizismus“ sollten Sie noch einmal gründlich überdenken. Skeptizismus ist die Basis der wissenschaftlichen Methode.
Wenn Wissenschaft die Öffentlichkeit gewinnen will, dann gelingt das nur auf dieser Grundlage. Mit Verlautbarungsjournalismus oder Kniefällen vor Professorentiteln erreichen Sie überhaupt nichts. Sondern stärken die Antiwissenschaftlichkeit in der Bevölkerung nur weiter.
Beste Grüße
Peter Heller
P.S.: Wenn Sie die Hauptsätze der Thermodynamik, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit oder die Äquivalenz von Masse und Energie als „Ideologie“ bezeichnen wollen, dann in der Tat habe ich eine. Sonst nicht.
LikeLike
S.Hader
16. Februar 2015
„Aber einmal ganz ehrlich: Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der jeder, der eine andere Überzeugung hat als man selbst, für ein Feind gehalten wird?“
Eine gute Frage. Ich fürchte aber, dass das bei einem Teil der Diskutanten so läuft. Die friedliche Koexistenz im verbalen Sinne zwischen Netzusern unterschiedlicher Ansichten wäre ein erstrebenswertes Ziel, was leider recht selten realisiert wird. Das man quasi zum persönlichen Gegner erklärt wird, ist das eine. Beleidigungen im Netz, Aussperrung aus Foren, Anrufe beim Arbeitgeber des Gegners bis hin zu Gewaltandrohungen sind dann weitere Eskalationsstufen. Die Freund-Feind-Denkweise geht auch so weit, dass der Feind des Feindes pragmatischerweise zum Freund erklärt wird und selbst seine unwissenschaftlichen, unsinnigen Erklärungen erträgt, während man Aussagen nach aktuellem Stand des Wissens zensiert.
Sorry wenn ich da ein etwas düsteres Bild zeichne. Kann gut sein, dass das Miteinander von Diskussionspartnern außerhalb der „Klimaszene“ friedvoller vonstatten geht, es würde mich freuen. Ich hoffe auch weiterhin, dass man im Laufe der Diskussionen wieder ein Stück näher kommt, was gute Wissenschaftskommunikation ausmacht und welchen Anteil dabei der gegenseitige Umgang hat.
LikeLike
S.Hader
30. Januar 2015
Noch als Ergänzung, es wurde die Frage aufgeworfen, wie man mit Wissenschaftsskeptikern und Menschen umgehen soll, die kein Vertrauen in die Wissenschaft haben. Was ich mir generell wünschen würde ist, dass man in journalistischen Artikeln und anderen medialen Beiträgen beschreibt, wie Wissenschaft im allgemeinen funktioniert. Und was die wesentlichsten Unterschiede zwischen Wissenschaftlern und Skeptikern sind. Unterschiede wird man bestimmt nennen können, aber welche sind wirklich gravierend? Warum ist es beispielsweise so wichtig, wissenschaftliche Ergebnisse in Journals und Konferenzen zu veröffentlichen? Was ist der Sinn dahinter? Da kann man u.a. die Wissenschaftsgeschichte bemühen, als Wissenschaftler gar nicht so erpicht waren, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, weil sie damit ihr Geheimwissen und Macht abgaben.
Man wird, so glaube ich, nicht drumherum kommen, immer wieder die Basics dem einfachen Leser erklären zu müssen. Nur gut informierte Bürger sind weniger anfällig für Scharlatanerie. Man darf auch nicht vergessen, dass mediale Berichterstattung keinen repräsentativen Einblick auf die Wirklichkeit geben. Wer sich nur oberflächlich zu wissenschaftlichen Themen in den Medien informiert, wird mit Peer-Review Journalen eher Betrug, Günstlingswirtschaft und einseitige Wissenschaft verbinden, weil über solche Fälle öfters berichtet wurde. Die eigentlichen Gründe, Qualitätssicherung und Kommunikation in der Wissenschaft, werden in den Artikeln kaum genannt.
LikeLike
Reiner Korbmann
31. Januar 2015
Lieber Herr Hader, ich denke nicht, dass mehr Aufklärung über Wissenschaft das Problem löst. Alle Untersuchungen zum Defizit-Modell zeigen, dass es nicht stimmt, dass sogar gebildete Bürger oft kritischer wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüberstehen als weniger informierte. Empfehlung: Lesen Sie dazu den Originalbeitrag von Dietmar Scheufele (Link finden Sie hier: http://wp.me/p1XAlm-sp).
Was die Macht von Skeptikernin unserem gesellschaftlichen Leben angeht, erinnere ich mich gut an eine Mail, die Sie selbst mir letztes Jahr geschickt haben (und auf die ich leider noch nicht eingegangen bin), die ich hier als Antwort auf Ihre Kommentare wiedergeben möchte. Ich denke nicht, dass man gut damit leben kann:
„Sehr geehrter Herr Korbmann,
als Leser Ihres Blogs wollte ich Sie auf ein kaum beachtetes lokales Ereignis hinweisen, was in den Medien praktisch keine Beachtung fand. Trotzdem hat das Ereignis im entfernteren Sinne mit Wissenschaft und Kommunikation, oder genauer gesagt mit der Rolle der Wissenschaft in der Politik zu tun und wie beispielsweise Parlamente mit wissenschaftlichen Aussagen umgehen und sie selbst für ihre Argumentation nutzen.
In der letzten Woche fand im Umweltausschuss eine Anhörung im niedersächsischen Landtag statt. An sich ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang, der im Parlamentarismus häufig stattfindet. Schwerpunkt ist ein Klimaschutzgesetz für das Land Niedersachsen. Über Sinn und Zweck eines solchen Gesetzes kann man sich trefflich streiten, bemerkenswert waren die eingeladenen Redner. Während die Fraktionen von SPD und Grünen die klassischen Verteter aus dem Bereich Klimaforschung und weiteren interdisziplinären Bereichen einluden, nahmen sich CDU und FDP scheinbar vor, das absolute Kontrastprogramm mit ihren eingeladenen Experten aufzustellen. Darunter waren Michael Limburg (EIKE), Prof.Ewert (EIKE) und Klaus Ermecke (Selbständiger Ingenieur). Da sich selbige Personen selbst als Klimaskeptiker bezeichnen, ist diese Bezeichnung in dem Fall nicht als Beschimpfung gedacht.
Da die Wahrnehmung einer solchen Veranstaltung scheinbar sehr stark vom jeweiligen Blickwinkel abhängt, sende ich Ihnen mal zwei wirklich konträre Erlebnisberichte zu. Der erste stammt von EIKE: http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/klimaschutz-ja-bitte-oder-nein-danke-eine-anhoerung-vor-dem-umweltausschuss-im-niedersaechsischen-landtag/, der zweite von Stefan Rahmstorf vom PIK, der selbst Vortragender war: http://www.scilogs.de/klimalounge/der-anti-treibhauseffekt-herrn-ermecke/
Insbesondere Herr Ermecke hat sich zur Aufgabe gestellt, vor den Landtagsabgeordneten mit einfachen Temperaturenvergleichen zwischen der Sahara und dem Mond den atmosphärischen Treibhauseffekt zu widerlegen. Allerdings auch die Vorträge von Limburg und Ewert gingen in eine ähnliche Richtung, wenn auch nicht ganz so plump. Wirklich bemerkenswert finde ich, dass der CDU- und FDP-Vertreter ausgerechnet diese „Klimaexperten“ sich ausgewählt haben. Es gibt einige sogenannter „Klimarealisten“, die die gängigen Modellrechnungen kritisch betrachten, keine Freunde des IPCC sind und ein weitaus höheres Ansehen geniessen. Warum versuchte man wieder mal(!) Kritik an der Klimapolitik dadurch zu üben, indem man die prinzipielle Wirkungsweise von Treibhausgasen abstreitet? Ein Geheimnis, was von den Anwesenden nicht gelüftet wurde.
Was hat das jetzt mit Wissenschaft und Kommunikation zu tun? Ich denke, Politik braucht die Wissenschaft. Und auch Ausschusssitzungen mit Wissenschaftlern haben ihre Berechtigung. Im günstigstens Fall liefern Sie sprichwörtliche Expertise. Im Normalfall bleibt es aber leider ein Instrument, um auch den seltsamsten Argumenten einen seriösen Anstrich zu geben. Im günstigsten Fall kann ein Wissenschaftler mit guter Kommunikation seine laienhafte Zuhörer in kurzer Zeit auf die Hauptprobleme eines Sachverhalt hinweisen. Im ungünstigen Fall kann er seinen Zuhörern ein Floh ins Ohr setzen und zu Desinformation führen. Es gibt mit Sicherheit schwerwiegendere Fälle, wo seriös anmutende Wissenschaftler dem Gesetzgeber eine Einschätzung abgaben, die als zweifelhaft galt und das mit weitreichenden Folgen. Da kann man das lokale Ereignis in Hannover eher als wissenschaftliche Posse bezeichnen, ohne das die Wissenschaft da wirklich eine Schuld trägt. Erstaunlich fand ich nur, dass wirklich niemand dieses Thema medial aufgegriffen hat, außer in den deutschsprachigen Klimaforen war es nirgendwo großartig thematisiert wurden. Vermutlich scheuen sich Redakteure die sonst knochentrocken Fachvorträge aus irgendwelchen Ausschüssen den Lesern näher zu bringen. Potential hat es aus meiner Sicht als Leser sehr wohl.“
LikeLike
S.Hader
31. Januar 2015
Sehr geehrter Herr Korbmann, okay, vielleicht haben wir da unterschiedliche Sichtweisen, ich bleibe trotzdem optimistisch, dass man mit mehr Aufklärung, was Wissenschaft eigentlich macht, einiges erreichen kann. Denn Defizite sehe ich durchaus auch bei den gebildeten Menschen. Mir fällt bei den Diskussionen in Skeptikerforen auf, die ich aktiv und passiv verfolgt habe, oft erstaunliche Vorstellungen von wissenschaftlicher Arbeit zutage kommen, selbst von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Das fängt damit an, dass man glaubt, dass ein öffentlicher Geldgeber für Forschungsarbeiten nach Belieben die Ergebnisse festlegen oder manipulieren könnte. Das geht weiter, dass man nicht genau weiß, was Peer-Review bedeutet und warum man das überhaupt macht. Ob man all die Schreiber in den Foren mit mehr Aufklärung erreicht, weiß ich nicht, aber für unbedarfte Leser wäre es vielleicht einfacher, bestimmte Aussagen in Foren besser einzuordnen.
Unerwartet haben sie Publicity für meine eMail gemacht, was ein lokalpolitisches Thema aus dem letzten Jahr behandelt, was medial kaum im Fokus war. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mich darüber freuen soll oder doch etwas verwundert bin, dass meine eMail ohne Vorabfrage komplett veröffentlicht wurde. 🙂 Egal, ich stehe ja zu dem Inhalt. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn sie vielleicht doch irgendwann Zeit finden, ihre Ansicht zu dem Inhalt mitzuteilen, genauso auch von den Lesern dieses Blogs.
MfG
S.Hader
LikeLike
Schäfer
30. Januar 2015
Hallo Herr Korbmann,
nur eine kurze Ergänzung: selbstverständlich beschäftigen sich Skeptiker (auch in der GWUP) schon lange mit den psycho-sozialen Hintergründen von Irrationalismus, Glaubenssystemen, Aberglauben, Wahrnehmungsverzerrungen usw. Sie kennen psychologische Mechanismen wie Confirmation Bias, Kognitive Dissonanz und andere kognitive Täuschungen.
Nur mal ein paar kurze Beispiele:
Bördlein, C.: Die Bestätigungstendenz. Warum wir (subjektiv) immer Recht behalten. Skeptiker 13, 132 (2000)
Hood, Bruce M. (2011): Übernatürlich? Natürlich? Warum wir an das Unglaubliche glauben. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg.
Auch im GWUP Blog gibt es dazu Beiträge:
http://blog.gwup.net/2014/01/27/glaube-und-personliche-erfahrung-in-der-wissensgesellschaft/
oder
http://blog.gwup.net/2013/08/07/wissenschaft-pseudowissenschaften-und-die-demokratie/
oder
http://blog.gwup.net/2013/08/21/skeptiker-sind-nervig-uberheblich-und-unsympathisch/
Wie und warum man sich selbst täuscht, hat bspw. der Psychologe Prof. Rainer Sachse in seinem aktuellen Buch thematisiert: Manipulation und Selbsttäuschung: Wie gestalte ich mir die Welt so, dass sie mir gefällt: http://www.springer.com/medicine/book/978-3-642-54822-2
Ein Ansatz um auf Esoteriker & Co zuzugehen sind die jährlichen PSI-Test der GWUP in Würzburg. Dort werden doppelverblindete Testreihen durchgeführt und der Preis von 10000EUR wurde ausgelobt. Dies geschieht in einer wertschätzenden und sachlichen Atmosphäre. Die Ergebnisse sind eindeutig. Niemand ist besser als der Zufall. Die Quote an „alles klar, ich hab die Fähigkeit nicht, ich hab mich getäuscht, das war mir so nicht klar. Danke“, liegt bei nahezu Null. Ich glaube eine Person hat je so reagiert.Diese war aber auch nicht sonderlich emotional involviert.
Viele Grüße
LikeLike
Reiner Korbmann
30. Januar 2015
Lieber Herr Schäfer, ich glaube nicht, dass es gelingt, Wissenschafts-Skeptiker zum Zuhören oder zu einem echten Gespräch zu bringen, wenn man von Vornherein ihr Haltung in die Schublade „Selbsttäuschung“, „Wahrnehmungsverzerrungen“ oder „Aberglauben“ steckt. Wie wenig dieser Ansatz bringt, beschreiben Sie ja selbst.
LikeLike
AL
29. Januar 2015
Stimmen die Tags in dem Bildchen zur Wissenschafts-Skepsis? Zweimal „stimme zu“?
LikeLike
S.Hader
29. Januar 2015
Ein wichtiges und oft unbeachtetes Thema, wie ich finde. Wobei Wissenschaftsskeptizismus viele Facetten haben kann. Da gibt es die einen, die wie in der einen Umfrage sagen, die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben. Es gibt aber auch solche, die sich gar nicht auf Glauben und Gefühlen sondern auf Wissen berufen! Sie meinen, dass das Wissen aus der Wissenschaft fehlerhaft ist, falsch, verfälscht und das richtige Wissen findet keinen Einzug in die offizielle Wissenschaft, u.a. weil dort korrupte Zustände herrschen oder die Politik das verbietet. Es gibt nicht wenige, die der Ansicht sind, dass die Wissenschaftler keinen guten Job machen. Das alles spiegelt nicht meine Meinung wieder, aber das ist die Erfahrung aus einigen Jahren Skeptikerforen aller Art.
Ist das nicht ein ziemlich schlechtes Bild, was von der Wissenschaft in der Gesellschaft existiert? Ja und nein. Ich „glaube“ 😉 das ist kein neues Phänomen. Der Klassiker ist eigentlich die Evolutionstheorie. Man muss dabei gar nicht mit dem Finger auf die USA zeigen. Es gibt über Jahrzehnte weltweite Umfragen, die die Menschen eine simple Frage stellt, was denken Sie, woher kommen die Arten? In Industrieländern wie Deutschland gibt es regelmäßig Anteile von 20-30%, die die Evolutionstheorie nicht als Antwort geben, sondern ein höheres Wesen und/oder etwas in Intelligent Design vermuten. Mit mangelnder Schulbildung hat das nix zu tun, denn die Evolutionstheorie wird überall gelehrt. Aber eben nicht als beste Erklärung für unsere Natur angenommen. Steckt deshalb die Biologie und ihre angrenzenden Fachgebiete in einer gesellschaftlichen Krise? Nein. Man kann (zumindest hier) ganz gut damit leben. Aber ich finde wichtig, dass man als Wissenschaftler oder wissenschaftsneugieriger Mensch das weiß, das nicht jede wissenschaftlich etablierte Ansicht bis in alle Bevölkerungsschichten akzeptiert wird. Wissenschaft soll ja auch nicht dieselbe Rolle für die Menschen übernehmen, wie früher die Religion. Rationalismus und Wissenschaftlichkeit sind auch keine Dogmen, um ein gutes Leben zu führen.
Interessant fand ich zu erfahren, dass die öffentlichen Diskussionen über die Blogwahl nur die Spitze des Eisberges darstellte. Dass Skeptiker diskutierfreudig sind, das kann ich sehr wohl bestätigen. 😉 Vielleicht kann man deren zahlreiche Existenz wie mit der dunklen Materie vergleichen. Wenn man nur die Wissenschaftsjournale und Mainstream-Medien heranzieht, nimmt man sie praktisch nicht wahr. Aber wenn man mal in die Forenlandschaft anschaut oder eben repräsentative Umfrage liest, ist man nicht wirklich darüber überrascht. Aber man sollte es auch nicht überbewerten, wer viel rasselt, klappert und Krach macht, ist nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Übrigens was mich als ehemaliger Ossi mit am meisten bei diesen Pegida-Aufzügen ärgert ist die Anmaßung „Wir sind das Volk!“.
Aber letztendlich, Herr Korbmann, würde ich mich nicht so sehr über die Kritik grämen. Wir haben jetzt Ende Januar, dass bedeutet auch, dass Sie die nächsten 10-11 Monate wieder Ruhe vor diesen Leuten haben werden. Dezember 2015 ist dann wieder die nächste Wahl….und Dezember 2016 wieder….und wieder. In diesem Sinne, auf viele weitere Jahre und Wahlen. 🙂 Und sorry für meinen überlangen, etwas sperrigen Text.
LikeLike
ulrich schulz
28. Januar 2015
Viel besser kann man die derzeitige Situation im Verhältnis Wissenschaft – Gesellschaft nicht beschreiben bzw. kommentieren! Unumschränkt Bravo!
Daß Florian Freistätter so reagierte, hat mich doch ziemlich erstaunt. Sein Umgang mit Kommentatoren seines Blogs ist unaufgeregt und locker. Nun, ist seine Sache!
Den Blog „Grewi“ sollte man bitte nicht mit den mitgenannten pseudowissenschaftlichen Blogs in einen Topf werfen: Viele Artikel finden sich so oder ähnlich auch in den „seriösen“ Blogs – und ich bin sicher, nicht nur als Alibi. Die restlichen, vielleicht 20 – 30%, anderen Artikel bzgl. UFOs, Nessies und dgl. …
Ist doch hin und wieder interessant, die allgemeinen Interessen mal mitzukriegen! Von den leidigen Kornkreisen mal abgesehen – ist wohl ein Hobby des Verantwortlichen – scheint man auf „Grewi“ zumindest vernünftiger – was auch immer das heißt – mit Wissenschaft umzugehen.
Tatsächlich bin ich als Physiker hin und wieder schon irritiert bei manchen Inhalten. Mein Rat: Wenn’s nicht zu hanebüchen wird – locker bleiben! Die Welt wird nicht untergehen!
Nochmal Gratulation Ihnen bzgl. Verpreisung der Blogs und Ihres Kommentares.
Dipl.-Phys. Ulrich Schulz
LikeLike
Reiner Korbmann
28. Januar 2015
Danke für die Blumen. Aber was Grenzwissenschaften-aktuell angeht, sind wir nicht einer Meinung. Gerade die Mischung von Facts und Esoterik zeigt doch, dass es gar keine Kriterien mehr gibt. Ich kann in der Realität leben – versuche ich – ich kann in meinen Träumen leben – versuchen viele, geht meistens nicht gut. Schlimm aber ist, wenn man Träume und Realität nicht mehr auseinander halten kann – das endet in der Katastrophe.
LikeLike
Christian Reinboth
28. Januar 2015
Ich habe die Diskussion mit einigem Interesse verfolgt, allerdings nicht ganz verstanden, warum sie so hochgekocht ist, zumal ich nicht den Eindruck habe, dass eine Auszeichnung als „Teufelchen der Wissenschaft“ einem Skeptiker-Blog eine besondere Wertigkeit verleiht. Im Grunde sagt sie wenig mehr über das Blog aus, als dass es besonders viele Leser und Anhänger hat, die für es abstimmen – und diesbezüglich sind die Ergebnisse ja durchaus interessant.
Entscheidend scheint mir diese Zusammenfassung des Grundproblems im Artikel zu sein:
„In dieser Gesellschaft geht es nicht darum, wer recht hat, sondern wer mehr Menschen auf seinen Weg mitnehmen kann. Hier zählen nicht die besseren Argumente, sondern die Mehrheiten.“
Das ist faktisch sicher richtig, im Grunde ja aber völlig verkehrt und von (weitgehend) rational denkenden Menschen, die Wissenschaftler nun mal sind, schlicht schwer zu akzeptieren. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, inwiefern die wissenschaftliche Community in der Verantwortung steht, mit entsprechenden Gegenströmungen zu kommunizieren – die politischen Beispiele „Wutbürger“ und „Pegida“ wurden ja schon genannt. Bei den Wutbürgern mag das ja noch möglich sein – für diejenigen, die sich dem freiwillig aussetzen möchten, verpflichten kann man hierzu sicher niemanden – mit dem wissenschaftsskeptischen Äquivalent von Pegida zu sprechen, macht allerdings wirklich wenig Sinn. Letztendlich verbrennt man beim (fast immer vergeblichen) Versuch, Skeptiker zu überzeugen, eine Menge Zeit und Energie, die man auch in konstruktive Blogposts, Veröffentlichungen, Unterrichtsvorbereitung oder Experimente hätte investieren können, schafft sich darüber hinaus noch Feinde, die einen mit Blogposts und Wikis verfolgen und schadet damit im Extremfall dem eigenen Weiterkommen in der Wissenschaft. Und das kann man – zumindest in meinen Augen – eigentlich von niemandem erwarten. Wenn überhaupt, ist diese Art der kritischen Überzeugungsarbeit vom BMBF und großen Gesellschaften wie DFG, MPG oder Fraunhofer zu erbringen – sicher aber nicht von individuellen Forscherinnen und Forschern.
LikeLike
Reiner Korbmann
28. Januar 2015
Lieber Herr Reinboth, Sie haben recht, es ist für die Wissenschaft nicht einfach, mit Wissenschafts-Skeptikern zu kommunizieren, ich denke sogar: unter den heutigen Umständen unmöglich. Da gibt es zu große Hindernisse, die sich festgegraben haben und unüberwindlich sind, da hört niemand mehr dem anderen zu, geschweige denn, dass er auf seine Argumente wirklich eingeht. Daher meine Fragen: „Was treibt diese Menschen an?“ Ich selbst weiß es nicht, es ist auch zu weit von meinem eigenen Denken weg, und ich schätze, ,vielen geht es ähnlich. Aber erst wenn ich die Motivationen, Ängste und Werte dieser Menschen kenne, kann ich Strategien entwickeln, wie eine Kommunikation vielleicht doch erreicht werden kann.
Wissenschaft ist in Verantwortung, vor allem dafür, dass in unserem Land auch morgen und übermorgen noch Wissenschaft ihren Beitrag wie geschildert zur Gesellschaft leisten kann. Wie schnell „Wutbürger“ so etwas verhindern können und zu einem politischen Mainstream werden, zeigen nicht nur die Beispiele Stuttgart 21, die dritte Startbahn am Flughafen München oder die Grüne Gentechnik. Wissenschaft braucht auch in einer partizipativen Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen, die Privilegien, die ihr die Gesellschaft gewährt. Denn in unserer Gesellschaft entscheidet eben nicht, ob richtig oder falsch, sondern die Mehrheiten. Deshalb hat Wissenschaft die Verantwortung zu kommunizieren, auch mit denen, die mit Wissenschaft nichts am Hut haben.
LikeLike
Reiner Korbmann
23. März 2015
Der Trackback unten “ Der doppelte Korbmann….“ führt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit meinem Rückblick, die fast schon ins ungewollt Satirische abgleitet. Hier meine Antwort im Blog „ScienceFiles„:
Ach, es ist ja alles noch viel schlimmer. Dieser „doppelte Korbmann“ (Wieso „doppelt“? – Einer reicht zur Genüge!) ist ja nicht einmal ein ängstlicher, nach Kunden lechzender, profitgieriger und hosescheißender „Mittelschichtler“. Das wäre noch zu verkraften, schließlich lebt auch ScienceFiles von den Spenden profitgeiler Leute, die ihr Geld erst einmal verdienen, bevor sie es diesem Hort der Wahrheit überlassen. Nein, Korbmann muss nicht einmal Geld verdienen, keine Kunden akquirieren, sein Büro hat er längst zurückgedreht, nutzt nur noch die alte Mailadresse: Er bekommt Geld einfach so nach Hause geschickt – Korbmann ist nur ein Rentner, ein Tattergreis, vom Dingsheimer gezeichnet, sein Leben und seinen Blog lässt er schamloserweise von berufstätigen Rentenzahlern finanzieren.
Es ist daher höchst verdienstvoll, dass es euer Reporter, wie auch immer er heißt, in intensiven Recherchen während der letzten langen acht Wochen bis zum Transparenz-schaffenden Impressum des in den meisten Jahreszeiten unbedeutenden Korbmann’schen Blogs geschafft hat (bei ScienceFiles wäre ihm das nicht gelungen, da gibt man sich mit solchen bürokratischen Kleinigkeiten großzügigerweise gar nicht ab). Oder hat bei Euch das Genehmigungsverfahren für den Blogpost so lange gedauert? Im „About“ musste der Reporter entdecken, dass dieser Greis nicht nur keine Idee jenseits des Mainstreams hat – er hat gar keine Idee mehr. Er schwafelt da etwas von Wissenschaftler sollen besser mit der Gesellschaft kommunizieren. So etwas großartiges, wie „Grundsatzprogramm“ kann er offensichtlich nicht einmal buchstabieren. Und lernen ist schon gar nicht mehr drin, ob mit Druck oder ohne – der ist jenseits von gut und böse!
Eigentlich schade, dass dem – vermutlich männlichen – Reporter dabei die Seite „Ein Wort an die Damen“ entgangen ist. Gerade für ScienceFiles wäre dies ein gefundenes Fressen – Genderismus pur, ja sogar im Quadrat. Acht Wochen sind eben doch sehr kurz für eine gründliche Recherche. Die hätte nämlich auch gezeigt, dass dieser Korbmann gar nicht mehr in der Lage ist, die fünf ihm gestellten Mittelschulen-Niveau-Aufgaben zu bearbeiten – da hat Frau Dr. habil. Heike Diefenbach ihre Habilitation vielleicht ganz umsonst gemacht. Und vergessen hat Korbmann offensichtlich auch, den Blog Grenzwissenschaft-aktuell zum „Wissenschaft-Blog“ des Jahres zu küren, stattdessen hat er ihm ein „Blog-Teufelchen“ verliehen. Vielleicht sogar mit Absicht?
Doch eines sollte Euer Reporter noch lernen: Weiter zu zählen als bis 10. Ich habe mich noch einmal vergewissert: In diesem Jahr standen 25 Blogs auf der Liste für die Popularitäts-Revolution, plus acht für das Blog-Teufelchen. Und wenn Ihr mit Eurem Boykott “Gib’ dem Korbmann einen Korb” Erfolg habt, dann gibt es beim nächsten Mal vielleicht reale, nicht von Wahlkampagnen verzerrte Ergebnisse? Undenkbar, furchtbar! Kommt dann ScienceFiles eventuell gar nicht mehr vor?
LikeLike